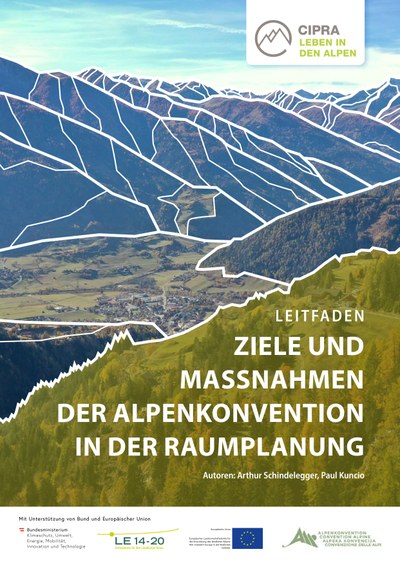Hochspannung in den Alpen
Energiewende und Renaturierung stehen oft im Widerspruch zueinander. Auf welche Weise kann alpine Raumordnung zwischen den verschiedenen Ansprüchen vermitteln? Dieser und weiteren Fragen ging die Jahresfachtagung der CIPRA am 27. Februar 2025 in Salzburg nach.
Staudämme, Photovoltaikanlagen und Windparks: Die Energiewende ist – neben niedrigerem Verbrauch und höherer Effizienz – eine der wichtigsten Antworten auf die Klimakrise. Gleichzeitig müssen beschädigte Ökosysteme wiederhergestellt werden. Beides beansprucht Raum, der in den Alpen knapp ist. Nutzungskonflikte sind vorprogrammiert. «Hinter diesen wachsenden Nutzungsansprüchen steht auch unser Lebensstil, der immer mehr Raum und Energieproduktion verlangt», meint Uwe Roth, Präsident von CIPRA International. «Also müssen wir loslegen mit dem Ausbau der Erneuerbaren, aber vor allem im Siedlungsgebiet und nicht in den letzten Naturräumen.» An der Tagung lieferten Expert:innen fachliche Denkanstösse, am Nachmittag stellten Teilnehmende in Gruppenarbeit die Thesen auf den Prüfstand.
Neue Landschaften, neue Nutzungsansprüche
Wo Gletscher abschmelzen, entstehen alleine in der Schweiz bis zum Jahr 2100 rund 700 neue hochalpine Seen mit der Gesamtfläche eines ganzen Schweizer Kantons. Thomas Kissling forscht an der ETH Zürich zur Zukunft dieser Landschaften zwischen Naturschutz, Tourismus und Energie. Die «Verklammerung verschiedener Nutzungsansprüche» könne ihm zufolge einen «neuen Typus einer alpinen Landschaft» schaffen, wie etwa beim ohnehin entstehenden See am abschmelzenden Gornergletscher nahe Zermatt. Dort könnte auch ohne eine grosse Staumauer Strom produziert werden, so Kissling. Doch wo wären biodiversitäts- und landschaftsverträgliche Anlagen für erneuerbare Energien überhaupt möglich? Anhand eines Kriterienkatalogs könne man Gebiete schon bei der Planung ausschliessen, etwa zum Schutz der Biodiversität, meint Lea Reusser von der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz. «Es gibt aber Naturpärke, wo es nicht per se verboten ist, eine Anlage aufzustellen», so Reusser.
Energiewende als gesellschaftlicher Lernprozess
Die Planung der Energiewende sei ein gesellschaftlicher Lernprozess, sagt Gernot Stöglehner von der Universität für Bodenkultur Wien: «Es funktioniert nur über Planungsziele, die man verbindlich festlegt und verfolgt.» Man müsse die Sachebene und die Wertebene zusammenbringen, so Stöglehner. «Beteiligung ist wichtig, auch in der Umsetzung, nicht nur im Planungsprozess.» Mangelnde Beteiligung kann zu massiven Konflikten führen, wie Mauro Varotto von der Universität Padua/I berichtet. Seit Jahren plant die Region Veneto einen Staudamm im Vanoi-Tal, unter anderem für die Wasserversorgung der dürregeplagten Landwirtschaft in der Ebene. Das Projekt wurde viel zu spät kommuniziert, was zu verhärteten Fronten führte. «Berge sind nicht nur Reservoirs oder Ressourcen. Dort spielen auch Tourismus, Bevölkerung und lokale Wirtschaft eine Rolle», betont Varotto. Das solle auch als Lehre dienen, wie solche Projekte zukünftig geplant werden.
Die Veranstaltung wurde von CIPRA International in Kooperation mit den CIPRA-Vertretungen aus Österreich und Deutschland sowie dem AlpPlan Netzwerk durchgeführt. Sie ist Teil des EUSALP-Vorsitzprogramms von Liechtenstein und Österreich. Ein Tagungsband zu Alpiner Raumordnung erscheint im Sommer 2025.
Weiterführende Informationen: www.cipra.org/de/ueber-uns/jahresfachtagungen/cipra-jahresfachtagung-2025