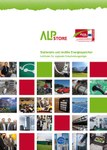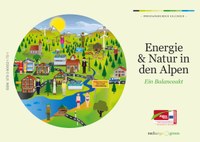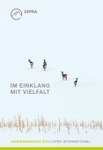Publikationen
Factsheet Alpen.nö
Ein 4-Seiter liefert einen Überblick über die Alpenkonvention und ihre Protokoll sowie über die Anwendung in Niederösterreich. Weitere acht Factsheets, die als Einlegeblätter gestaltet sind, präsentieren zu den Protokollen der Alpenkonvention Best-Practise Beispiele aus Niederösterreich, sowie rechtliche Anwendungen der Protokolle. Mehr…
Factsheet Alpen.nö
Ein 4-Seiter liefert einen Überblick über die Alpenkonvention und ihre Protokoll sowie über die Anwendung in Niederösterreich. Weitere acht Factsheets, die als Einlegeblätter gestaltet sind, präsentieren zu den Protokollen der Alpenkonvention Best-Practice Beispiele aus Niederösterreich, sowie rechtliche Anwendungen der Protokolle. Mehr…
SzeneAlpen Nr. 100 - Frauen im Vorstieg
Ihr Beitrag für Natur und Gesellschaft in den Alpen Mehr…
Naturschutz, Werte, Wandel
Schutzgebiete, wie Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks, sind Flaggschiffe der Naturschutzbewegung. Die Autoren zeichnen die Entstehungsgeschichte folgender Schutzgebiete nach: Nationalpark Berchtesgaden (DE), Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin (DE), Nationalpark Hohe Tauern (AT), Nationalpark Donau-Auen (AT), Naturpark Dobratsch (AT), Schweizerischer Nationalpark (CH) und Nationalparkkandidat Parc Adula (CH). Die Darstellung reicht vom Aufkeimen des Naturschutzgedankens in der Mitte des 19. Jahrhunderts, bis zur Frage, welchen sozialen, politischen und ökonomischen Herausforderungen sich die Schutzgebiete des 21. Jahrhunderts stellen müssen. Mehr…
Wandern und Gesundheit - Konzepte und Erfahrungen für einen wachsenden Markt
Wandern ist gesund, fast 70% der deutschen Bevölkerung wandert zumindest gelegentlich. Und der überwiegenden Mehrheit sind die gesundheitsfördernden Aspekte des Gehens in der Landschaft dabei sehr bewusst und ein wesentliches Motiv. Wie sich das "Medikament Wandern" professionell in die Produkt- und Destinationsentwicklung einbinden lässt, stellt dieser Band erstmals detailliert und aus unterschiedlichen Perspektiven zusammen. Mehr…
Landschaft und Energiewende
Der Einfluss erneuerbarer Energien auf die Landschaft. WSL Bericht Heft 21, 2014 Mehr…
Musterhektar - Beschreibung der Methode und Anwendung
Das Hilfsinstrument “Musterhektar” unterstützt Akteure bei der Entscheidungsfindung zur Landschaftsnutzung für erneuerbare Energien. Es wurde in Vorarlberg entwickelt und getestet. Mehr…
Stationäre und mobile Energiespeicher - Leitlinien für regionale Entscheidungsträger
Im Projekt AlpStore haben 19 Partner aus den 7 Alpenstaaten die Bedarfe für und die Anforderungen an Kurz- und Langzeitspeicher untersucht. Sie haben stationäre Speicher betrachtet, die jederzeit zur Verfügung stehen, und mobile wie die von Elektrofahrzeugen, die zeitweise nicht mit dem Netz verbunden sind. Sie beschäftigten sich mit Biogas und Wasserstoff. Sie haben ausgedienten Fahrzeugbatterien ein „zweites Leben“ gegeben und Kommunikationsstrategien entwickelt, um die Bürgerschaft aktiv in Willensbildungsprozesse einzubeziehen. Mehr…
[3312] Piz Buin. Literarische Erkundungen 1865-2015
Der 1865 von Johann Jakob Weilenmann und Gefährten erstmals bestiegene Piz Buin (heute 3.312 m) ist nicht nur einer der höchsten Gipfel der Silvretta, sondern mit Sicherheit auch der meistbeschriebene. Das liegt an der Aufmerksamkeit, die ihm früh schon als höchster Erhebung Vorarlbergs entgegengebracht wurde, wie auch an seiner prominenten Grenzlage zwischen Österreich und der Schweiz und wohl auch am Wohlklang seines romanischen Namens – denn wer wü̈rde schon Hotels oder Sonnencreme nach einer ‚Ochsenspitze‘ benennen? Die von Bernhard Tschofen zusammengestellte und kommentiere Anthologie versammelt Texte aus 150 Jahren. Ihr Spektrum lässt den Piz Buin als beispielhaften Gipfel erkennen, denn in ihnen spiegeln sich die Alpenbegeisterung und die Entwicklung der bergsteigerischen Praxis in all ihren Facetten. Die ausgewählten Beiträge reichen von den heldenhaften Berichten der ersten Besteiger über die augenzwinkernd mitgeteilten Abenteuer verrückter Engländer und schwärmerische Schilderungen alpinen Erlebens bis zum Heftchenroman. Sie umfassen aber auch bislang kaum bekannte Zeugnisse von Widerstandskämpfern und Verfolgten des Nationalsozialismus sowie zeitgenössische Texte. Mehr…
Votum für die Natur - politische Empfehlungen für den Alpenraum
Wie können erfolgreiche Naturschutzmaßnahmen umgesetzt werden? Die politischen Empfehlungen in diesem Dokument zeigen einige der Lücken auf, die geschlossen werden müssen, sowie Bedürfnisse, die es zu berücksichtigen gilt. Darüber hinaus unterstreichen sie die große Wirkung, die politische Situationen auf den Naturschutz haben. Mehr…
Zwischen Wildnis und Freizeitpark - Eine Streitschrift zur Zukunft der Alpen
Der bekannte Alpenforscher Werner Bätzing, Autor des Standardwerks Die Alpen, stellt in dieser Streitschrift pointiert die Leitideen der wichtigsten Alpen- Perspektiven dar, die gegenwärtig diskutiert werden, und bewertet sie kritisch im Hinblick auf die mit ihnen verbundenen Auswirkungen auf die Alpen. Da Bätzing diese Auswirkungen in allen Fällen als problematisch und bedenklich beurteilt – Verlust von Lebens-, Wirtschafts-, Umweltqualität –, skizziert er im letzten Teil dieser Streitschrift eine ganz andere, eine »unzeitgemäße« Perspektive für die Alpen, in der die Alpen als dezentraler Lebens- und Wirtschaftsraum eine Zukunft erhalten sollen. Mehr…
Energie & Natur in den Alpen. Ein Balanceakt. - Immerwährender Kalender
In diesem immerwährenden Kalender werden die wichtigsten Erkenntnisse des Projekts erläutert. Angesprochen sind insbesondere Entscheidungsträger von der lokalen bis zur alpenweiten Ebene. Der Kalender begleitet übers Jahr den Entscheidungsfindungsprozess der fiktiven Stadt Oberdasing, die sich auf den Weg gemacht hat, ihre erneuerbaren Energien verantwortungsvoll zu nutzen. Mehr…
Gewässer schützen – Wasserkraft nützen. Flüsse im Spannungsfeld der Interessen
Diese Broschüre entstand im Rahmen des LE-Projekts »Gemeingut Wasser im Spannungsfeld der Interessen: Umsetzung des NGP: Wir informieren SIE – SIE bilden sich Ihre Meinung«. Der Schlüssel zur Findung einer Lösung, die alle Interessen an Österreichs Gewässern zufriedenstellt, ist ein möglichst hoher Wissensstand aller Beteiligten – von Kraftwerksbetreibenden über jeden und jede EnergieverbraucherIn bis hin zum/zur LandwirtIn, FischerIn oder BürgermeisterIn – über die Vor- und Nachteile der Wasserkraft sowie ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Diesem Bildungsauftrag hat sich auch das Projekt »Gemeingut Wasser im Spannungsfeld der Interessen« des Umweltdachverbandes in Kooperation mit dem Österreichischen Fischereiverband verschrieben. Als Teil dieses Projekts bringt die vorliegende Broschüre das umfangreiche Thema Wasserkraft mittels anschaulich und objektiv aufbereiteter Fakten und Daten einem breiten Leserkreis näher. Denn: Nur eine ausgewogene und breite Diskussionsbasis kann zukünftige Entscheidungsprozesse erleichtern, die Kommunikation auf Augenhöhe und die konstruktive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen fördern und somit eine nachhaltige Energieversorgung bei gleichzeitigem Erhalt der letzten unberührten sowie der besonders wertvollen Fließgewässerstrecken gewährleisten. Mehr…
Jahresbericht CIPRA Schweiz 2014
Aktivitäten der CIPRA Schweiz 2014 Mehr…
EEA Report No 8/2014 - Adaptation of transport to climate change in Europe
Challenges and options across transport modes and stakeholders. This report explores current climate change adaptation practices concerning transport across European countries. It provides an overview on the challenges and state adaptation action, a review of a number of initiatives in different countries, and conclusions on a potential way forward. Its purpose is to stimulate discussions among the many different stakeholders concerned with transport adaptation. Opening the perspective on the transport system and sector as a whole should inspire and encourage learning from practices across modes and areas of responsibility and support efforts to mainstream adaptation within transport-related policy and practices. The factual information collected is based on data available in the Climate-ADAPT information platform, a literature review, case studies provided by many stakeholders, and a questionnaire on transport and adaptation addressed to EEA member countries in 2013. Mehr…
Mountain Research and Development, Vol 35, No 1, available online and open access
Two papers explore how French and Swiss mountain family farms adapt to socioeconomic and political change. Others study benefits of a pro-poor value chain for Indian farmers; Peruvian periurban farmers’ views on urbanization; European intergenerational practices for protected area management; a low-cost DEM methodology for the Andes; alpine forest communities’ response to climate variability in Nepal; and the impact of fertilizer on degraded grasslands in Tibet. Mehr…
Schmetterlinge - Vielfalt durch Wildnis
Wer hätte gedacht, dass der Nationalpark Kalkalpen mehr als 1.500 verschiedene Schmetterlingsarten beherbergt? Dieses Gebiet von rund 200 Quadratkilometern gilt als eines der letzten großflächigen Wildnisgebiete Mitteleuropas, geprägt von naturnahen Wäldern, unverbauten Wildbächen und ursprünglicher Gebirgslandschaft. Vielerorts verschollene Schmetterlinge finden hier ein letztes Rückzugsgebiet und viele von ihnen lassen sich noch häufig beobachten. Vom talnahen Schlucht- und Auwald, über alpine Grasmatten und Felsbiotope zu den sanften Almen und Wiesen: Anhand von über 20 charakteristischen Lebensräumen wird in diesem Buch die jeweils typische Schmetterlingsfauna dargestellt. So wird das Buch zum wertvollen Begleiter bei Wanderungen in den Ostalpen und speziell im Gebiet des Nationalpark Kalkalpen. Mehr…
Der Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand
Nach wie vor bestehen nennenswerte Potenziale, Notwendigkeiten und Möglichkeiten, den Energieverbrauch weiter zu verringern. Die zum Beheizen der Wohnung vorgesehene Energie sollte so wirksam und effizient wie möglich eingesetzt werden. Das leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Zudem spart ein geringerer Energiebedarf Heizkosten. Langfristiges Ziel sollte aus Sicht des Umweltbundesamtes ein klimaneutraler Gebäudebestand sein, den ein niedriger Nutzenergiebedarf und eine (möglichst vollständige) Versorgung mit erneuerbaren Energien kennzeichnen. Mehr…
Sitzen im öffentlichen Raum
Ein Überblick zum urbanen Aufenthalt Mehr…
CODE24 - Corridor 24 Development Rotterdam-Genoa
Ein Korridor – Eine Strategie Für eine dauerhafte interregionale Allianz zur integrierten und ausgewogenen Entwicklung des Rhein-Alpen Korridors Mehr…
BAFU - Neue Publikation: Luftverschmutzung und Gesundheit
Mit jedem Atemzug gelangen Luftschadstoffe wie Feinstaub, Stickstoffdioxid oder Ozon in unsere Atemwege und die Lunge. Sie werden dort abgelagert und können kurz- oder langfristig Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Diese gemeinsam vom Bundesamt für Umwelt und Kollegium für Hausarztmedizin herausgegebene Publikation gibt eine aktuelle Übersicht über die gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung und deren Bedeutung für die Bevölkerung der Schweiz. Mehr…
Umweltbericht 2015
Der Bericht «Umwelt Schweiz 2015» gibt einen Überblick über den Zustand und die Entwicklung der Umwelt in unserem Land. Er zieht Bilanz aus den Massnahmen, die der Bund ergriffen hat, um die Umweltqualität zu verbessern, und zeigt auf, wo weiterer Handlungsbedarf besteht. Ausserdem vergleicht er die Fortschritte der Schweiz mit denen ihrer Nachbarländer und wirft einen Blick in die Zukunft, indem er Umweltperspektiven für das Jahr 2030 zusammenfasst. Mehr…
Aktuelle Situation und Handlungsansätze zur Weiterentwicklung des Nachtreisezugverkehrs in Deutschland
Studie im Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Mehr…
Nachhaltige Mobilitätsangebote für Wohnsiedlungen
Mit dem Projekt «MIWO – Mobilitätsmanagement in Wohnsiedlungen» wurden Instrumente geschaffen, welche es Liegenschaftsverwaltungen und Gemeinden ermöglichen, die wohnungsbezogene Mobilität umweltgerechter zu gestalten. In zehn Pilotsiedlungen in den Städten Basel, Bern, Effretikon, Horgen, Lausanne und Zürich wurde das Instrumentarium getestet und liegt nun in einem Handbuch vor. Dieses zeigt den Weg von der Analyse bis hin zu den Massnahmen auf. Die MIWO-Hilfsmittel helfen, die Mobilität und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner besser zu verstehen. Mit den passenden Massnahmen können Anreize geschaffen werden, damit die Bewohnenden künftig weniger Verkehrsemissionen erzeugen. Mehr…
Interreg, ESPON, URBACT – die Zusammenarbeit kennt keine Grenzen
Seit über 20 Jahren unterstützt die Schweiz mit Interreg die grenzübergreifende Zusammenarbeit und seit 2002 auch mit ESPON und URBACT. Die Programme tragen dazu bei, dass sich Staaten und Regionen in Europa wirtschaftlich, sozial und ökologisch weiterentwickeln. Zum Start in die neue Förderperiode 2014–2020 hat regiosuisse gemeinsam mit Partnern eine Broschüre herausgegeben und die Website-Rubrik «Interreg / ETZ» überarbeitet. Mehr…